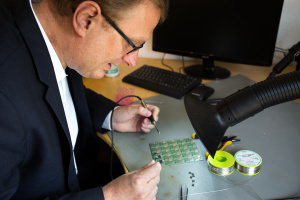Kommunen stärker entlasten – Kinderbetreuung ausbauen
Die Kommunen weiter finanziell zu entlasten und ihre Handlungsfähigkeit zu sichern, zählt zu unseren prioritären Aufgaben in dieser Legislaturperiode. Mit einem entsprechenden Gesetzentwurf, der in dieser Woche im Deutschen Bundestag beraten wurde, sollen die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 zusätzliche Hilfen in Höhe von jährlich 1 Mrd. Euro erhalten.
Vorgesehen ist, dass der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 geringere Einnahmen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 500 Millionen Euro jährlich erhält. Diese kommen dann den Kommunen zugute. 2017 und 2018 will der Bund auf 100 Millionen Euro jährlich aus der Umsatzsteuer verzichten und diese den Ländern überlassen. Geplant ist außerdem, den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Hartz-IV-Bezieher zu erhöhen, was in den Jahren 2015 bis 2017 zu Mehrausgaben von jährlich 500 Millionen Euro führt, was wiederum die Länder entsprechend entlastet. Der Bund erwartet dabei, dass die Länder die Entlastung an die Kommunen weitergeben, um deren Handlungsfähigkeit zu stärken.
Zudem soll im Rahmen des geplanten Gesetzes das bestehende Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ auf 1 Mrd. Euro aufgestockt werden. Förderfähig sollen Investitionen sein, die seit dem 1. April 2014 begonnen wurden und die entweder neue Plätze schaffen oder Plätze erhalten, die ansonsten weggefallen wären. Förderfähig sind laut Gesetzentwurf auch solche Investitionen, die der gesundheitlichen Versorgung, der Inklusion von Kindern mit Behinderung sowie der ganztägigen Betreuung dienen. Genannt wird etwa die Einrichtung von Küchen und Verpflegungsräumen. Die Regierung rechnet damit, dass mit der Aufstockung des Sondervermögens zusätzlich zu den bisher zugesagten 780.000 Plätzen weitere rund 30.000 Plätze geschaffen werden.
Den entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung finden Sie hier.