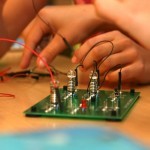2. Praxistag Inklusion: Wer Inklusion will, braucht Sonderpädagogik
Bei meinem zweiten Praxistag zur inklusiven Bildung konnte ich in den Alltag der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule (FvB) in Bergkamen-Heil schnuppern. Die FvB ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Dort werden 285 Schülerinnen und Schüler aus dem nördlichen und mittleren Kreis Unna in 24 Klassen von etwa 70 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die Schule arbeitet als Ganztagsschule.
Bei meiner Veranstaltung zur Inklusiven Bildung im vergangenen Jahr hatte mich die Schulleiterin eingeladen, die Schule zu besuchen, um ein besseres Bild zu bekommen, wie eine Förderschule funktioniert. Das habe ich gerne angenommen und ich haben tatsächlich ein anderes, vielleicht vollständigeres Bild davon bekommen, wie diese Schulform arbeitet.
Der Praxistag beginnt am Morgen mit dem Besuch der Unterstufe. In der FvB lernen die jüngsten Schülerinnen und Schüler mehrerer Jahrgangsstufen zusammen in einer Klasse. Zunächst lösen sie individuell Aufgaben mit Hilfe von passenden Lernmaterialien wie Puzzle oder Spiele. Danach gibt es einen gemeinsamen Morgenkreis, bei dem die Schülerinnen und Schüler einen täglich wiederkehrenden Rhythmus durchlaufen. Dabei füllen sie ihr Klassenhaus, das symbolisch an der Wand hängt, mit ihren Bildern, Namen und Symbolen. In der Klasse sind zwei Lehrerinnen anwesend, die sich um die Kinder kümmern und sie bei der Lösung der Aufgaben unterstützen. Nach dem Morgenkreis geht es in zwei Lerngruppen weiter.
Für mich geht danach weiter in die Oberstufe. Hier sind die Schülerinnen und Schüler schon etwas älter, schätzungsweise um die 14-16 Jahre. Auch hier arbeiten sie individuell an der Lösung ihrer Aufgaben. In dieser Klasse haben die Lehrer das Wochenplan-Prinzip eingeführt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Arbeitspensum für eine ganze Woche zu Beginn und entscheiden selbst, in welcher Reihenfolge sie die einzelnen Aufgabenblöcke abarbeiten. Die einen rechnen, die zweiten lesen und die dritten machen freie Aufgaben. Am Ende der Stunde wird Bilanz gezogen und die Schüler geben an, welchen Aufgabenblock sie bearbeitet haben. Durch das Abhaken von Blöcken auf einer für alle sichtbaren Übersicht können sie ihren Arbeitsfortschritt dokumentieren und sehen. In der Pause nehmen dann alle ihr gemeinsames Frühstück ein, das eine andere Gruppe aus dieser Klasse in der Zwischenzeit vorbereitet hat.
Die Pausenstruktur hat die Schule vor einigen Jahren umgestellt. Die Schülerinnen und Schüler verbringen ihre Pause beaufsichtigt außerhalb des Klassenraumes in einem bestimmten Bereich der Schulgebäude und auf dem Hof. So können sie selbst darüber entscheiden, wie und mit wem sie ihre Pause verbringen möchten.
Im Anschluss nehme ich an einer Gesprächsrunde von Lehrerinnen, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern der Schule teil. Die Schülerinnen und Schüler der Werkstufe berichten zum Beispiel über ihren Alltag im Metallbau oder in der Wäscherei. Sie kommen aber auch sehr direkt zu dem, was ihre Schule ausmacht („Die Lehrer sind cool“) oder zu dem, was sie von ihrer Schule und dem Leben nach der Schule erwarten. Sie wollen etwas machen, „um im Leben einmal weiter zu kommen“. Das übergreifende Thema unserer Region, der Übergang von der Schule in den Beruf, ist auch hier das wichtigste Thema für Schüler und Eltern. Diese sorgen sich darum, dass es zu wenige Plätze für ihre Kinder in Werkstätten für Behinderte gibt und sie regen u.a. an, dass mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung im öffentlichen Sektor geschaffen werden. Die meisten von ihnen haben sich bewusst für den Besuch einer Förderschule und gegen den gemeinsamen Unterricht in einer allgemeinen Schule entschieden.
Meine vorläufige Schlussfolgerung dieses zweiten Praxistags: wer inklusive Bildung will, d.h. möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen lassen, der braucht die Sonderpädagogik. In der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule arbeiten Expertinnen und Experten für die Pädagogik für besondere Kinder. Ihr Wissen, ihre Möglichkeiten, auf Kinder mit Behinderung individuell einzugehen, werden auch in der inklusiven Bildung benötigt. Es wäre ein Irrglaube, wenn man meinte, alle Lehrer müssten nur ein bisschen Sonderpädagogik im Studium zusätzlich studieren und schon könnten sie auch inklusiv unterrichten.
Viel mehr geht es darum, dass alle Lehrerinnen und Lehrer mit heterogenen Lerngruppen arbeiten können und zusammen mit Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen im Team eine inklusive Klasse unterrichten können. Davon sind wir leider in unserem derzeit auf Selektion angelegten gegliederten Schulsystem entfernt. Aber ich bemerke auch, wie das Interesse an der jeweils anderen Berufsrichtung zunimmt und wie die Bereitschaft zur Kooperation wächst. Inklusion ist derzeit eines der wirklich großen Themen der Bildungspolitik. Und alle können voneinander lernen. Ich würde gerne die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ermuntern, ihre Kompetenz im Umgang mit heterogenen Lerngruppen etwa oder mit jahrgangsübergreifendem Unterricht selbstbewusst in die Inklusionsdebatte einzubringen. Denn davon können auch die allgemeinen Schulen lernen.
Der nächste Praxistag im Oktober führt mich dann in den gemeinsamen Unterricht. Darauf bin ich gespannt. Und nach diesem Praxistag werde ich Bilanz ziehen und gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem Landtag und den Kreispolitikern ganz konkrete nächste Schritte vereinbaren. So können wir gemeinsam daran mitwirken, dass der Kreis Unna tatsächlich ein Vorreiter für inklusive Bildung wird!